Frau Professorin Bögel, war für Sie eine Karriere in der Wissenschaft immer schon gesetzt?
Nein, ich hatte nie vor, Professorin zu werden. Das gilt auch für die Promotion: Obwohl meine Eltern beide promoviert haben, stand diese Option nicht auf meiner Agenda. Auch wenn es heute so wirken könnte, als sei ich immer einem konkreten Ziel gefolgt. Aber: Lebensläufe sind ja nur eine Form von Storytelling. Vielmehr habe ich immer gemacht, was mich begeistert hat. Mein Interesse galt der Frage, was Menschen bewegt und zusammenbringt. Deshalb habe ich Psychologie studiert.
„Lebensläufe sind nur eine Form von Storytelling.“
Wann haben Sie dann den ersten Karriereschritt gemacht?
Der Gedanke an eine Promotion kam erstmals 2010 bei meiner Arbeit bei der Alfred Toepfer Stiftung in Hamburg auf. Ihre Zielsetzungen, einen gesellschaftlichen Bereich wie Kultur zu fördern und Nachhaltigkeit voranzutreiben, verschmolzen zum Forschungsgegenstand „Nachhaltigkeitskommunikation“. Darauf habe ich mich als Doktorandin an der Universität Lüneburg konzentriert. Damals noch ein absolutes Nischenthema – mir wurde oft gesagt, auch von wohlmeinenden Menschen, damit könne ich nicht in der Wissenschaft bleiben. Deswegen habe ich lange überlegt aufzuhören. Für mich war nämlich klar: Eine wissenschaftliche Karriere, für die ein Themawechsel notwendig gewesen wäre, wollte ich nicht.
Was hat Ihnen geholfen, Ihren Weg weiterzugehen?
Ein Coaching mit Spezialisierung auf den Wissenschaftsbetrieb, viel Selbststärkung und Unterstützung aus meinem engsten Umfeld. Vor ein paar Jahren wurde mein Thema dann zunehmend nachgefragt in Gesellschaft, Politik und auch Wissenschaft. Seitdem bekomme ich mehr Projektanfragen, als ich bearbeiten kann. Zumal ich wiederum innerhalb des Themenbereichs Nachhaltigkeit eine Nische abdecke.
„Während mir damals wegen meines Nischenthemas
noch mit Skepsis begegnet wurde, bekomme ich heute
mehr Projektanfragen, als ich bearbeiten kann.“








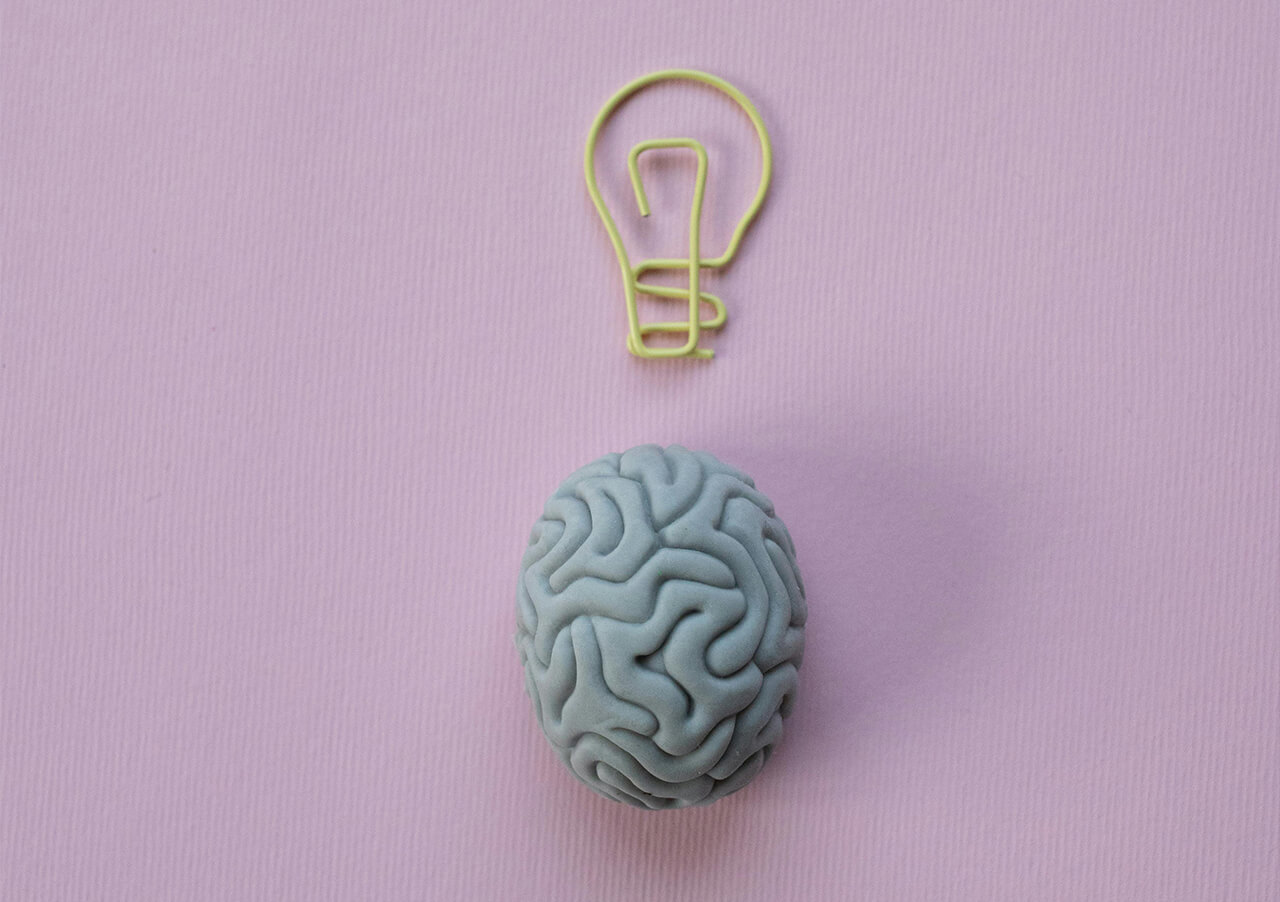

 1786 Nr. 12
1786 Nr. 12 1786 Nr. 11
1786 Nr. 11 1786 Nr. 10
1786 Nr. 10 1786 Nr. 9
1786 Nr. 9 1786 Nr. 8
1786 Nr. 8 1786 Nr. 7
1786 Nr. 7 1786 Nr. 6
1786 Nr. 6 1786 Nr. 5
1786 Nr. 5 1786 Nr. 4
1786 Nr. 4 1786 Nr. 3
1786 Nr. 3 1786 Nr. 2
1786 Nr. 2 1786 Nr. 1
1786 Nr. 1